
(Triggerwarnung: Im heutigen Blogbeitrag geht es um Selbstmord. Lest den Beitrag bitte nur, wenn ihr euch dazu in der Lage fühlt. Solltet ihr oder jemand, den ihr kennt, selbstmordgefährdet sein, könnt ihr rund um die Uhr kostenfrei unter der Telefonnummer 116 123 mit jemandem sprechen und Hilfe bekommen.)
Zugegeben, das heutige Thema ist alles andere als schön. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, ob ich hier darüber schreiben soll. Letztendlich habe ich mich dafür entschieden. Denn mein Anspruch in diesem Blog ist es, das Leben mit PEG authentisch und mit all seinen Facetten zu behandeln. Dazu gehören manchmal eben leider auch weniger schöne Themen.
Enorme Stärke
Grundsätzlich bin ich ein Mensch, der das Leben positiv sieht und es genießt. Auch wenn die Umstände manchmal alles andere als einfach sind. Seit meiner Jugend lautet mein Motto: „Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg – notfalls wird eben ein neuer angelegt!“ Doch auch ich gerate manchmal an meine mentalen Grenzen. (An meine körperlichen natürlich auch. Nahezu täglich. Aber das ist ein anderes Thema.) Und das ist vollkommen in Ordnung. Denn, so schön das Leben auch ist, es ist eben nicht immer einfach. Sich das einzugestehen und eventuell um Hilfe zu bitten, hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern zeugt, im Gegenteil, von enormer Stärke. Wenn es euch also einmal so gehen sollte, dass ihr denkt, es ist alles zu viel, holt euch bitte Unterstützung! Sprecht mit Freunden oder Familie oder gegebenenfalls auch fremden Menschen. Aber sprecht mit jemandem. Denn eine andere Perspektive auf eine Situation hilft uns, die Sachen klarer zu sehen.
Überfordert mit PEG
Im Zusammenhang mit meiner PEG bin auch ich schon überfordert gewesen. Ziemlich zu Anfang. Interessanterweise nicht, als mir der absolut unfähige Arzt seinerzeit vorschlug, eine Magensonde zu legen (die ganze Geschichte könnt ihr hier nachlesen). Sondern erst später in der Rehaklinik (mehr dazu an dieser Stelle), als ich selber realisierte, dass ich wirklich nicht um eine PEG drumherum kommen würde. Ich weiß noch ganz genau, welche Gedanken ich damals hatte: „Jetzt musst du künstlich ernährt werden. Als nächstes künstlich beatmet. Und dann ist dein Leben eh bald vorbei …“
So nachvollziehbar diese Gedanken auch sind, genauso unsinnig sind sie tatsächlich auch. Ich lebe heute seit über 20 Jahren mit einer Magensonde. Seit letztem Jahr auch mit einer nicht-invasiven Beatmung (also genau genommen nur eine Atemunterstützung) in der Nacht. Und mein Leben war noch nie besser.
Angst vor dem Unbekannten
Aber das wusste ich damals noch nicht. Ich hatte einfach wahnsinnige Angst vor dem Unbekannten. In einer solchen Situation tendieren wir Menschen dann leider oftmals dazu, uns dieses Unbekannte in den schlimmsten Farben auszumalen. Und so stand ich damals wortwörtlich an einem Abgrund. Ich hatte die Klinik verlassen, um ein wenig spazieren zu fahren, den Kopf frei zu bekommen. Die Stationsärztin hatte mich eigentlich nicht gehen lassen wollen. Denn sie hatte Angst, dass ich mir etwas antun würde, nachdem ich gerade diese vermeintliche Hiobsbotschaft erhalten hatte. Offensichtlich war diese Sorge nicht unbegründet gewesen. Aber ich war schon immer ziemlich überzeugend. Sie hatte mich also raus gelassen. So stand ich nun also mit meinen Rollstuhl an einem erhöhten Weg, an dessen Rand eine Wiese steil mindestens 20 m bergab führte. Wäre ich mit meinem schweren Rollstuhl über die Kante gefahren, wäre das garantiert böse ausgegangen.
Aber was, wenn es gut wird?
Gerne würde ich an dieser Stelle schreiben, dass ich mich nach einiger Zeit besann und beschloss, positiv in die Zukunft zu blicken und mit der Einstellung „Aber was, wenn es gut wird?“ in die Klinik zurückzukehren. Doch die Wahrheit ist, dass ich einfach noch mehr Angst davor hatte, dass es unglaublich wehtun würde, wenn ich diesen Abhang herunter führe. Also saß ich stattdessen einfach so lange heulend da, bis mich der Zivi der Station fand, der mir hinterher geschickt worden war. Denn auch wenn sie mich fälschlicherweise hatte gehen lassen, so hatte meine Stationsärztin doch richtig erkannt, dass ich jemanden zum reden brauchte. Allerdings nicht den Zivi, sondern die Psychologin der Klinik, zu der er mich bringen sollte.
unendlich dankbar
Heute bin ich meinem jungendlichen Ich unendlich dankbar, sich damals dagegen entschieden zu haben, diesen Abhang herunter zu fahren. Denn ich hätte so viele wahnsinnig schöne Erlebnisse verpasst. Keinem dieser Erlebnisse stand meine PEG irgendwie im Wege. Im Gegenteil. Sie ermöglichte erst, dass ich so lange am Leben war, all dies erleben zu können.
Natürlich kann uns die Diagnose, fortan mit einer Magensonde leben zu müssen, Angst machen. Denn für viele von uns, ist dies eine unbekannte Thematik. Und Unbekanntes kann Angst machen. Sehr viel Angst. Deshalb ist es wichtig, mehr über dieses unbekannte Thema zu lernen und sich mit Menschen auszutauschen, die sich damit auskennen. Mehr über das Leben mit einer Magensonde lernen könnt ihr (hoffentlich) in diesem Blog. Austauschen könnt ihr euch ebenfalls. Und zwar mit mir. Hierfür gibt es mein neues Angebot des 1:1-Austausch.
Ich hoffe, mein heutiger, sehr persönlicher Beitrag, hat euch geholfen, euch mit euren Sorgen nicht alleine zu fühlen und dem Leben mit PEG positiv entgegentreten zu können.


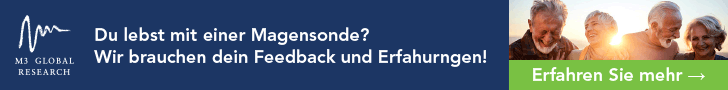
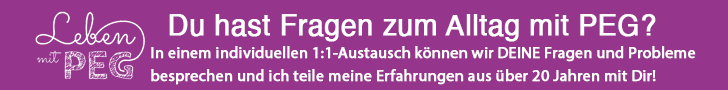
Comments